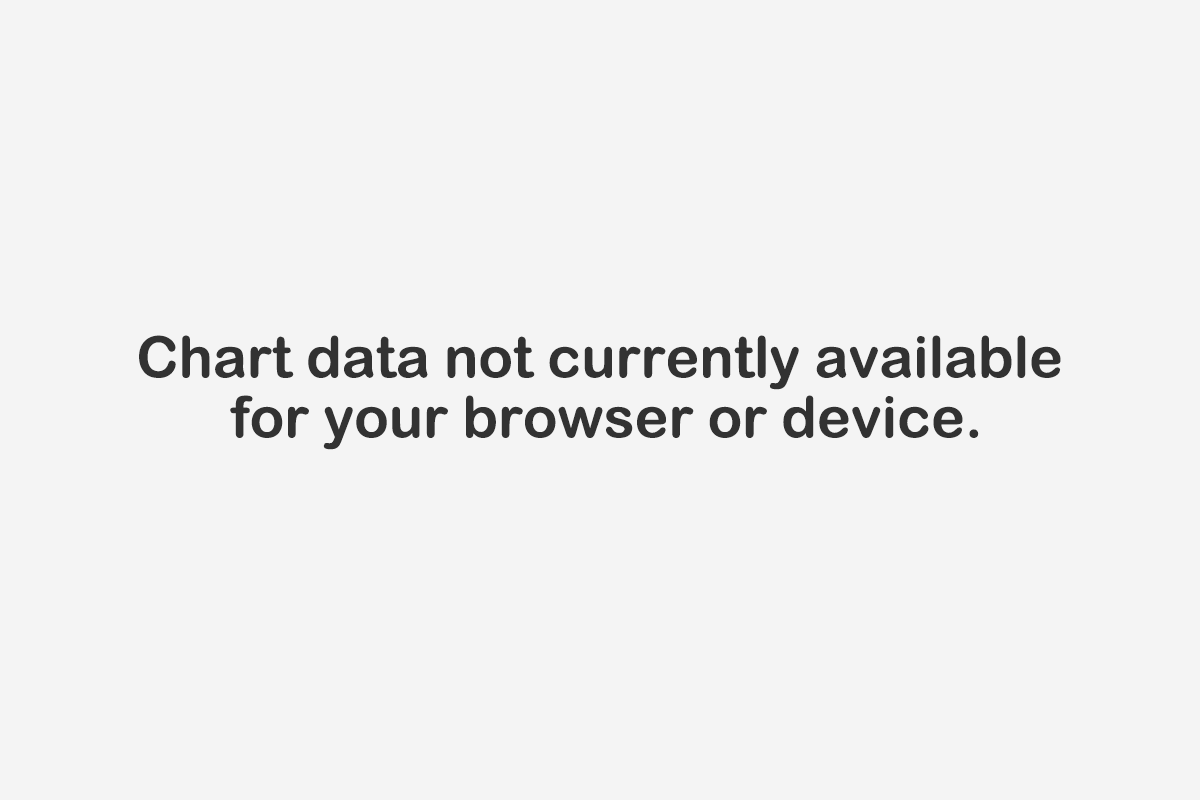Der Branchen-Monitor stellt monatsaktuelle Informationen über die wichtigsten Kennzahlen, Trends und Risikoindikatoren in den jeweiligen Branchen bereit. Vom durchschnittlichen Insolvenzrisiko über den Zahlungsverzug und die Liquidität der Branche.
+++ Insolvenzen 2023 gestiegen +++ Negativtrend wird auch 2024 prägen +++ Ein weiterer Anstieg der Insolvenzen in den nächsten Jahren ist zu erwarten +++ Höchststand im September 2023 +++ Gast- und Baugewerbe sind besonders betroffen +++ Mögliche Gründe des Anstiegs: Nachholeffekte aus der Pandemie, Ukraine-Krieg, Inflation und Auslaufen des COVInsAG (COVID-19-Insolvenzaussetzungsgesetz) +++ Unternehmen sollten nun verstärkt ihr Risikomanagement verbessern und Maßnahmen zur Risikominimierung ergreifen +++
Der Insolvenz-Monitor für Deutschland soll Sie dabei unterstützen, den Überblick über das aktuelle Insolvenzgeschehen zu behalten.
Im Folgenden finden Sie die Darstellung und Analyse über die Entwicklung der Firmeninsolvenzen:
- in Gesamtdeutschland
- nach Bundesländern
- nach Unternehmensgröße
- nach Wirtschaftssektoren
- Hintergründe und Basis
- Methodik und Statistik
Überblick über die Firmeninsolvenzen in Deutschland
Peer Hitschke, Senior Data Scientist bei Creditsafe, fasst die aktuelle Insolvenz-Situation zusammen:
In den Jahren der Pandemie gab es einen außerordentlichen Staatseingriff. Überbrückungsgelder und andere finanzielle Hilfen haben vielen Unternehmen dabei geholfen, die Umsatzeinbußen zu kompensieren. Doch die Rückzahlungen stehen bei vielen Betrieben noch aus und krisenbedingte Folgen wirken teils auch weiterhin auf den Erfolg von Unternehmen. Ergo, wurden über mehrere Jahre Risikoprognosen abgegeben, die bis dato nicht eingetreten sind. Mehrere Tausend Insolvenzen haben sich somit akkumuliert. Sobald die staatlichen Hilfen ausgelaufen sind, werden die angestauten prognostizierten Effekte eintreten – wodurch eine deutliche Zunahme der Insolvenzen in den nächsten Jahren zu erwarten ist.
Peer Hitschke
Risk Expert
Übersicht der Firmeninsolvenzen je Bundesland
Der Graph stellt die Entwicklung der Insolvenzen in den Bundesländern im Vergleich zum Jahr 2018 dar. Dabei werden zunächst die ganzen Jahre miteinander verglichen.
In 2020 sank die gesamtdeutsche Insolvenzrate im Vergleich zum Vorjahr um rund 14 % und in 2021 beschleunigte sich der Trend, 25 % weniger Unternehmen musste einen Insolvenzantrag stellen als noch im ersten Krisenjahr. In keinem Bundesland war ein Anstieg zu beobachten. Neben der Einsetzung des COVInsAG (COVID-19-Insolvenzaussetzungsgesetzes) sind im ersten Krisenjahr auch andere Einflussgrößen zu beachten, so z. B. der Umstand, dass die zuständigen Amtsgerichte vorübergehend nicht besetzt waren und es zu Verzögerungen in der Bearbeitung der Anträge gekommen ist.
Die Grafik lässt erkennen, dass es deutliche Unterschiede zwischen den Bundesländern gibt. So sanken die Insolvenzen in Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen in 2020 überaus stark, wohingegen in Nordrhein-Westfalen, Bremen und Baden-Württemberg erst in 2021 ein deutlicher Rückgang verzeichnet wurde.
Unternehmensinsolvenzen nach Wirtschaftssektoren
Unabhängig von der aktuellen Wirtschaftslage gibt es große Unterschiede bei den Insolvenzraten in einzelnen Industriezweigen. Die Sektoren „Verkehr und Lagerei“, „Gastgewerbe“ und „Baugewerbe“ haben generell eine hohe Insolvenzrate im Vergleich zum gesamtdeutschen Durchschnitt. Die Gründe sind vielfältig.
Bei der Betrachtung der Insolvenzentwicklung zeigt sich über alle Wirtschaftssektoren ein deutlicher, wenn auch unterschiedlich starker Rückgang der Insolvenzen in 2021 im Vergleich zum Referenzjahr. Auch im ersten Krisenjahr konnte diese Entwicklung bereits für einen Großteil der Branchen – mit Ausnahme der "Wirtschaftsdienstleister" – beobachtet werden.
Betrachtet werden muss zuerst die Härte und Dauer der COVID19-bedingten Schließungen und wie viel Einfluss das auf den jeweiligen Geschäftsbetrieb hatte. Des Weiteren spielen die überregionalen Geschäftsabhängigkeiten, die relativen Unternehmensgröße einer Branche, mögliche staatliche Hilfen und natürlich auch die oft genannte Systemrelevanz eine Rolle. Der hier zu sehende Rückgang der Insolvenzen lässt also keinen pauschalen Rückschluss zu.
Im Zuge des Ukraine-Kriegs und der steigenden Inflationsrate müssen einige Branchen mit neuen Herausforderungen rechnen. So belasten u. a. steigende Energiekosten, Rohstoffmangel und Lieferengpässe Firmen aus Baugewerbe, Gummi- und Kunstoffproduktion, Fahrzeugproduktion und Elektrotechnik.
Wenn Märkte in eine Krise geraten, erhöht sich der Druck auf die Unternehmen und deren Sektoren. Der aktuelle Effekt auf einzelne Branchen und deren Widerstandsfähigkeit ist dabei unterschiedlich ausgeprägt. Der Ausgang bleibt offen und es gibt gute Gründe für manche Branchen, ein freundlicheres Szenario zu entwerfen als für andere.
Ein Faktor allerdings, der in jeder Branche derzeit für erhöhtes Risiko steht, ist die Liquidität. Der durchschnittliche Liquiditätsbestand, also die „Reichweite“ der Liquidität, lag über alle Branchen bei knapp 30 Tagen. Je nach Branche variiert diese Reichweite jedoch stark und liegt im Falle der Dienstleistungsbranche beinahe nur halb so hoch wie z. B. im Baugewerbe.
Die vielfältigen Indikatoren zur Abschätzung der "Überlebensfähigkeit" erfordern deshalb einer näheren Betrachtung. In unserem Branchen-Monitor können Sie weitere aktuelle Finanz- und Risikokennzahlen zu diversen Branchen abrufen - von der Liquidität über die Ausfallwahrscheinlichkeit bis zum durchschnittlichen Zahlungsverzug.
Creditsafe Branchen-Monitor
Doch nicht nur diese Industrien sollten angesichts der aktuellen Lage im Blick behalten werden. Zur Minimierung des unternehmerischen Risikos ist es sinnvoll, viele Informationen über den Markt und seine Teilnehmer jederzeit zur Verfügung zu haben. Creditsafe unterstützt Sie hierbei. Dafür bietet sich z.B. eine automatische Firmenüberwachung an, um frühzeitig über Veränderungen bei Kunden und Lieferanten informiert zu werden.
Hinweis über die Verwendung der Zahlen
Wenn Sie die Insolvenzzahlen im Rahmen einer journalistischen Tätigkeit verwenden möchten, kontaktieren Sie uns gerne.
Möchten Sie einzelne Insolvenzbekanntmachungen oder Ihre eigene Unternehmensbonität einsehen?
Auf der Creditsafe-Plattform finden Sie tagesaktuelle Informationen zu über 430 Mio. Unternehmen weltweit - inklusive Bonitätsindex, Zahlungserfahrungen zu einzelnen Firmen, Gruppenstrukturen von Konzernen, Geschäftsführerauskünfte und vieles mehr.
Hintergründe und Grundlagen der Firmeninsolvenzen
Derzeit bestehen mehrere Faktoren, welche das Insolvenzgeschehen in Deutschland maßgeblich prägen. Dabei lassen sich u. a. zwei externe Einflüsse festmachen:
a) Nachbeben der Corona-Pandemie
Im Rahmen des von der Bundesregierung beschlossenen Schutzschilds für Unternehmen und Beschäftigte in Deutschland wurde die Insolvenzantragspflicht für Unternehmen in weiten Teilen bis zum 30. April 2021 ausgesetzt. Dieser Schritt sollte den Unternehmen die nötige Zeit verschaffen, um die drohende Insolvenz dauerhaft zu überwinden.
Jedoch setzte die Einführung der Insolvenzantragspflicht marktbereinigende Kräfte in Teilen aus. Unternehmen wurden durch staatliche Hilfen künstlich am Leben gehalten, ohne die Kernprobleme zu beheben. In den kommenden Jahren ist somit mit dem Anstieg von Firmeninsolvenzen durch Nachholeffekte zu rechnen.
b) Ukraine-Krieg als Katalysator bestehender Probleme
Im Zuge des Ukraine-Konflikts werden viele Unternehmen in Deutschland und weltweit vor neue Herausforderungen gestellt. Neben direkt betroffenen Unternehmen mit Kapitalbeteiligungen in der Ukraine und Russland sehen sich weite Teile von steigenden Energiepreisen betroffen. Hierfür ist es wichtig, die wirtschaftlichen Zusammenhänge zu verstehen:
Auf der einen Seite bewirkt die Konjunkturerhöhung aufgrund der steigenden postpandemischen Industrieproduktion eine erhöhte Energie-Nachfrage. Auf der anderen Seite besteht aufgrund der derzeitigen Situation eine hohe Unsicherheit über künftige Gaslieferungen aus Russland. So beschloss die EU im Zuge des sechsten Sanktionspakets, den Import von russischem Öl bis zu 90 % zu reduzieren. Auch ein gänzlicher Importstopp der Gaslieferungen aus Russland ist denkbar. Da das Energie-Angebot nicht proportional zur Nachfrage der Industrie steigt, steigen damit auch die Gaspreise, was wiederum die Kosten von Stromproduktion durch Erdgas erhöht.
Jedoch sind steigende Energiepreise nicht die einzige Herausforderung für viele Industrien: Wirtschafts- und klimabedingte Lieferkettenengpässe und Rohstoffmangel – u. a. von Holz, Aluminium, Kupfer und Kunststoff – haben die Industrie bereits vor dem Ukraine-Krieg belastet.
Allerdings wirkt der Krieg nun als Katalysator für bereits vorhandene Herausforderungen der deutschen Wirtschaft. Viele Unternehmen reagieren mit steigenden Preisanpassungen, um interne Kosten weiter tragen zu können. Doch das führt zu einer Geldentwertung – die Inflationsrate steigt. Für viele Unternehmen könnte das eine Überschuldung bedeuten.
Hinweise zur Methodik und Statistik
Creditsafe Deutschland legt folgende Daten der Auswertung zugrunde:
- Untersuchte Unternehmen
Der Fokus des Insolvenz-Monitors liegt auf Insolvenzen aus dem Insolvenzregister, welche sich auf am Handelsregister registrierte Unternehmen beziehen und somit ein amtliches Aktenzeichen aufweisen.
Aufgrund der einheitlichen und transparenten Datenlage ist eine hohe Qualität und Genauigkeit gewährleistet. Dadurch ist es möglich auch kleinere Bewegungen, Trends und Marktsignale abzubilden.
Die Analyse betrachtet eine Grundgesamtheit von über 2 Mio. im Handelsregister gemeldeten Unternehmen. Dabei gilt die Definition des im Handelsregister eingetragenen Kaufmanns nach § 19 HGB.
Die Bewertung der Unternehmensgröße folgt der Einzelnorm nach § 267 HGB. Zum Zweck der vereinfachten Darstellung werden sie in die Segmente "klein" sowie "mittel/groß" gruppiert. Über Unternehmen ohne Finanzzahlen liegen keine Informationen vor, die eine Einordnung gemäß o. g. Definition erlauben.
- Insolvenzdefinition
Von den möglichen Zeitpunkten in der Phase eines Insolvenzverfahrens wird für die Datenerhebung der Zeitpunkt der Antragstellung verwendet.
- Klassifikation der Wirtschaftszweige
Die Einteilung der Industriesektoren und Branchen erfolgte nach der Klassifikation der Wirtschaftszweige des Statistischen Bundesamtes von 2008. Sie dient der einheitlichen Verwendung und Erfassung von wirtschaftlichen Tätigkeiten von Unternehmen zur Erstellung amtlicher Statistiken. Sie berücksichtigt die Vorgaben der statistischen Systematik der Europäischen Gemeinschaft (NACE), die für alle EU-Mitgliedstaaten verpflichtend ist.